Sander |
Binnendüne |
Erosionstal |
Moor
|
Heide |
Toteissee |
Wanderdüne |
Watt
Wasser und Wind bewirkten die
Sonderung der unterschiedlichen Bestandteile
in dem großen Gemenge der glazialen Ablagerungen. Die leichten
Teile (Sand und Schluff) führten sie mit sich und lagerten sie an geeigneten Plätzen neu ab. Zunächst
war das Schmelzwasser der Transporteur. Je feiner der Sand war,
umso weiter wurde er verfrachtet und schließlich in weiten Schwemmsandebenen (Sandern) vor dem Eis abgelagert. Wo diese trocken
fielen, griffen die Winde zu. Sie nahmen den Sand auf, sie
verwehten ihn, oft weit, und konnten ihn lokal zu Dünen
aufhäufen. Dieses luftige Spiel geschah über lange Zeiträume - denn auch
nach dem vollständigen Niedertauen des Landeises dauerte es, bis
eine beständige Pflanzendecke die sandigen Flächen schützte und
den Sand fest hielt.
äolisch abgelagerter Sand |
|
 |
| |
 |
So bildeten sich in der spät- und postglazialen
Landschaft
verbreitet Flugsandflächen und Binnendünenareale, oft
in beachtlichen Ausmaßen.
Am ausgeprägtesten natürlich in
den Schwemmsandebenen
vor dem Haupteisrand (auf der heutigen Geest), häufig auch
in Urstromtälern, eher selten jedoch im Kontext kleinerer
Binnensander inmitten des Moränenlandes, dann verursacht
durch die unterschiedlichen Stadien des Eisrandes und
seiner Schmelzwasseraustritte.
Meist zeigen Binnendünen eine unregelmäßige Form ihrer
Kuppen und Täler, eine Auswirkung der verwirbelnden Aus-
blasungsvorgänge.
|
| |
|
|
Wo die Befestigung der Sandfelder nicht gelang und der dem
Wind ausgesetzte Sand seine Mobilität behielt, behielten
Dünen die Möglichkeit, zu wandern - sie blieben
Wanderdünen.
Inzwischen finden wir diese nicht bezähmbaren Naturphänomene bei
uns eigentlich nur noch im Küstenbereich.
Die ansässigen Landeigner versuchten stets, sich der
Übersan-dung ihres Landes mit Anpflanzungen zu wehren. Das
erfolgte in erster Linie mit Kiefern, in Küstennähe auch mittels
Strandhafer.
Aber auch das Umgekehrte geschah nicht selten: dass durch Rodung
und Überweidung bewachsener Dünengebiete und Flug-sandfelder die
Sandgebiete wieder aufgebrochen und aktiviert wurden. Daraus
konnten Heiden entstehen. |
|
 |
| |
|
Wanderdüne auf
Sylt |
| |
|
| Beispiele von Binnendünenfeldern: |
| |
| Ein sehr schönes Binnendünenfeld ist das
der Süderlügumer
Binnendünen im nördlichen Schleswig-Holstein
nahe der dänischen Grenze. |
Mit seinen offenen Heiden stellt es heute nur einen kleinen
Teil der im Übrigen mit Nadelgehölzen aufgeforsteten
Binnendünenlandschaft der Lecker Geest dar. Diese gehört zu den
Altmoränen-Komplexen der Hohen Geest, die im Verlauf des Weichsel-Glazials eine Flugsandüberlagerung erhalten hatten.
Die feinen Flugsande wurden vom Wind aus den Sandern, aber auch
aus Schmelzwasserrinnen aufgenommen - im Süderlügumer Bereich
aus den Rinnensystemen der Lecker Au und der Wiedau - lokal zu Dünen
aufgeweht. Die heutigen Dünenformen
gehen allerdings nicht bis auf diese frühe Zeit zurück.
Bäuerliche Nutzung und die Anpflanzung von Strandhafer
bedeuteten verändernde Eingriffe.
Weitere Informationen, auch zur Flora und Fauna,
hier.
Bild rechts: Weite Teile des
Dünenfeldes sind mit dem feinen Gras der Drahtschmiele
bewachsen. Ihre lockeren Rispen wirken gleich einem rötlichen
Schleier über dem Ganzen, unterbrochen von den grünen Flecken der
Krähenbeere. |
|
 |
| |
|
| Auch das Heidekraut (Besenheide) kommt verstreut in vielen
kleinen Flecken vor - hat es aber schwer sich zu
behaupten, so scheint es. Am ehesten gelingt es ihm an den wenigen
offeneren Stellen. |
 |
 |
 |
| Im Zentrum des Dünenfeldes ist das Relief
bewegter, dort ist unter anderem eine Ausblasungswanne ausgebildet. |
 |
 |
 |
Binnendünen stellen einen
ausgiebig besonnten und durch den sandigen Untergrund extrem
trockenen Lebensraum dar. Seine Bewohner sind an diese
speziellen Gegebenheiten angepasst - und durch diese
Anpassung auf sie angewiesen.
Darauf nimmt die Ausweisung als Naturschutzgebiet Rücksicht, sie
erfolgte hier bereits 1938. |
| |
Literaturempfehlung:
U. Heintze, W. Riedel: "Die Schleswigsche Geest", Husum 2021
(darin S. 291-297 "Dünenlandschaften im Nordwesten der
Schleswigschen Geest") |
| |
| |
| |
Der vielgestaltigen und artenreichen
Binnendünenlandschaft von Nordoe liegt eine
komplexe und interes-sante Entstehungsgeschichte zugrunde. Sie
wird z. B.
hier (S. 6 ff),
im Kontext des Managementplanes des LLUR 2010, dargestellt.
Knapp zusammengefasst:
|
| Die Münsterdorfer Geestinsel ist ein durch
die glaziale Ur-Stör von der Itzehoer Geest getrennter Teil der
Holsteinischen Vorgeest. Zusätzlichen tektonischen "Auftrieb" hat dieses
Gebiet erhalten durch einen unter der Lägerdorfer Kreide aktiv
aufdrängenden Salzstock. Im Zuge der pleistozänen Vereisungen
erfolgte die eigentliche, bis heute im Wesentlichen erhaltene
Oberflächen-Ausformung. Während die Moränendecke der Kaltzeiten
vergleichsweise dünn blieb, wirkte das Schmelzwasser umso
nachhaltiger - sowohl im Stör- als auch im Elbe-Tal.
In allen Vereisungen reichte das ausgedehnte Elbe-Urstrom-tal
bis an die Geestinsel und schuf mit seinen gewaltigen
Schmelz-wassermengen an ihrem Südrand die heute immer noch
markanten (fossilen) Kliffhänge, oberhalb der Rethwischer
Marsch. Zugleich wurden weiträumig mächtige Sander
aufgeschüttet. Spätere Trans-gressionsphasen machten die
Geestinsel tatsächlich zeitweilig zu einer echten Insel, was zur
Ausbildung von Stranddünen führte (die heute noch in Resten
vorhanden sind). |
|
 |
| |
|
|
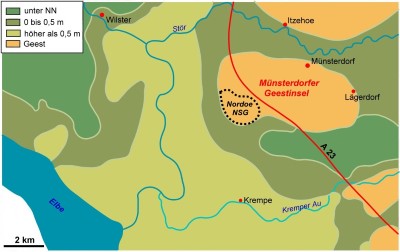 |
|
Zur Situation der Münsterdorfer Geestinsel:
eine stark vereinfachte Höhenschichtenkarte.
Mittels schwarzpunktierter Linie
ist die Lage des
Naturschutzgebietes Nordoer Binnendünen markiert.
in Farbe übertragene, ergänzte Kartenskizze nach Angaben in:
Degn/ Muuss 1966: Topographischer Atlas
Schleswig-Holstein, S. 148
|
|
|
|
| Dem 407 ha großen Naturschutzgebiet liegen alte Reste
einer unverkoppelten Allmende-Landschaft
zugrunde, die durch die spätere Nutzung als militärischer
Übungsplatz vor moderner (intensiver) Landwirtschaft, Entwässerung,
Umbruch, Düngung oder flächiger Aufforstung bewahrt wurde. |
| |
 |
 |
 |
| |
| |
Das Gebiet enthält daher aus alter - und neuer
- Zeit
eine Vielfalt
unterschiedlicher Lebensräume:
offene und bewaldete Dünen, offene Sandflächen, Magerwiesen, Feuchtheiden
(in Dünentälern), Sandheiden (mit Heidekraut und Ginster),
zahlreiche Kleingewässer, moorige Bereiche,
Eichenkratts...,
es enthält aber auch Gehölzanpflanzungen aus
der Zeit
der militärischen Nutzung.
Der mit dem Nordoer Schutzgebiet geschaffene Verbund
verschiedenster Biotope ist die Grundlage für einen großen,
wertvollen Artenreichtum. |
|
 |
| |
Es bedarf mehr als eines Spaziergangs, um dieses
an Lebensformen reiche, an leuchtend auffallenden, aber auch an
unscheinbaren Vertretern reiche Gebiet wirklich kennen zu lernen.
Hier nur ein paar Momentaufnahmen: |
 |
 |
 |
 |
 |
|
quirlige Knorpelmiere |
Bergsandglöcken |
Rundblättriger Sonnentau |
Bärlapp |
Glockenheide |
 |
 |
 |
 |
 |
| Lungenenzian |
Augentrost |
Kreuzblume (und
Besenheide) |
Teufelsabbiss |
Feldthymian |
Das Tierleben wahrzunehmen ist weniger einfach - es
sei denn, man begegnet einer Herde der Landschaftspfleger... die
sind nicht zu übersehen. Neben den Burenziegen sind Exmoor-Ponys,
Galloways und Schottische Hochlandrinder im Einsatz.
Aber mit Glück sieht man auch kleinere Formate - das
eine oder andere standortbezogene Insekt... |
 |
 |
 |
|
Burenziegen wirken der Verbuschung entgegen |
Wespenspinne mit Nest |
Sandbienen wiederum bauen ihre Nester im Boden |
|
|
|
|
|
Sehr empfehlenswert ist diese informative Präsentation:
https://www.botanik-steinburg.com/files/NordoerHeideGesamt2011.pdf |
|
|
|
|
|
|
|
Die Binnendünenlandschaft im
Sorgwohlder Raum
- mit den Teilgebieten der Binnendünen, der Krummenorter Heide
und des Loher Geheges - stellt nur kleine
Reste einer einst ausgedehnten Moor-, Dünen- und Heidelandschaft in dieser Region dar. Wie viele weitere der Sandgebiete auf
der Geest hatte sie sich ab dem Ende des Weichsel-Glazials
ausgebildet. Die damals verbreitete baumlose Tundra war von
sandreichen Schmelzwassern durchströmt, die ihre Sandfracht
weitflächig ablagerten. Und auch hier wehte der Wind den Sand zu
Flugsandfeldern und Dünen auf. Die sukzessive sich entwickelnde
Vegetation führte noch in vorgeschichtlicher Zeit zur Bewaldung
- die später jedoch den bronze- und eisenzeitlichen Siedlern zum
Opfer fiel. Die dadurch entstandenen Heideflächen wurden durch
die bäuer-liche Bewirtschaftung ab dem Mittelalter, durch
weitere Entwaldung, durch Beweidung und Plaggenwirtschaft
weit-gehend zerstört. Im 19. Jh. wurden Maßnahmen ergriffen, die
wiederum offenen Sandflächen festzulegen - durch
Bepflanzung mit Strandhafer und durch Aufforstung.
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Mit Kiefernwald bestandenes Binnendünen- gebiet - das
Loher Gehege. |
Der historische Ochsenweg führte bei Sorgbrück
durch die Flugsandfelder. Seine Trasse ist partiell erhalten. |
|
|
|
|
|
Diese Entwicklungsetappen sind beispielhaft für die meisten
Flugsandfelder und Dünengebiete der Niederen Geest. Die meisten
dieser Areale sind heute bewaldet, einige wenige werden unter
Naturschutzgesichtspunkten (möglichst) offen gehalten und als
Heidedünen gepflegt. |
|
|
|
|
|
|
|
Die Lütjenholmer
Heidedünen wurden 1938 unter Schutz gestellt.
Und auch dieses Gelände ist nur ein "winziges Überbleibsel jener
Heidelandschaft, die vor 1900 noch weite Landesteile bedeckt
hatte"
Zitat-Quelle. |
|
|
|
|
Obwohl heute nicht unerhebliche Teile der Heide vergrast sind,
haben sich verschiedene Formen von Feucht- und Trockenheiden
sowie kleine Heidemoore erhalten. |
 |
 |
 |
 |
| In den kleinen
Feuchtheideflecken kommt die seltene Moorlilie vor und in kleinen Beständen der
in Mooren heimische Gagelstrauch. Im Heidemoor kontrastieren die
rötlichen Bestände des Knöterichs zum saftig-grünen Torfmoos. |
 |
 |
 |
 |
| Den
Lütjenholmer Heidedünen sind durch das umgebende Agrarland enge
und klare Grenzen gesetzt. Es bildet einen grünen Ring um das
farbenreiche Heideland. Das gut 16 ha große, durch einen Weg
erschlossene und mit Infotafeln versehene Gelände kann in kurzer
Zeit durchwandert werden. |
|
|
| Ebenfalls 1938 wurde die mit nur 7 ha deutlich kleinere "Düne
am Rimmelsberg" unter Schutz gestellt. Eine
Besonderheit des Gebietes ist ihr Bestand an in
Schleswig-Holstein selten gewordenen Wacholderbüschen. Der Vergrasung durch die Drahtschmiele wird durch jährliches
Abplaggen versucht, Einhalt zu gebieten. |
|
|
|
|
|
Ein weiteres Beispiel für ein durch Bepflanzung weitgehend
stillgelegtes Wanderdünengebiet ist
Ulla Hau auf Fårö,
einer nördlich von Gotland gelegenen kleinen Insel. Hier hatte
während der Kleinen Eiszeit die Dünenausbildung begon-nen und
ließ die größte Parabeldüne Schwedens entstehen. Ende des 19.
Jh. wurden die Sandfelder mit Strandhafer, Birken und Kiefern
bepflanzt. Bild rechts unten:
Trichter des Ameisenlöwen.
Siehe auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ullahau |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
Literatur:
Müller M. J. 1999: Genese und Entwicklung
schleswig-holsteinischer Binnendünen. Ber. z. dt. Landeskunde
37,129-150.
Zölitz, R. 1989: Landschaftsgeschichtliche Exkursionsziele in
Schleswig-Holstein. Wachholtz-Verlag, Neumünster. |
