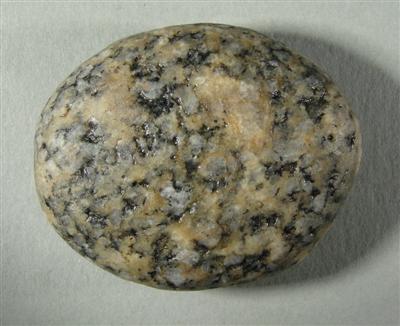Landschaft - Geologische Fenster - Helgoland,
Düne
Helgoland | Liether Kalkgrube
|
Kalkberg Segeberg |
Morsum Kliff
| Lägerdorfer Kreidegruben
Ursprünglich gab es auch im Bereich der heutigen
Düne hoch
aufragende Felsen - am nordöstlichen Rand der damaligen
Halb-insel (siehe historische Karte). Sie waren von nahezu gleicher
Höhe wie der Buntsandstein der Hauptinsel, bestanden aber nicht
aus rotem Sandstein, sondern aus hellem Muschelkalk und Kreide
- das "Witte Kliff". Im 17. Jh.
existierte auch noch eine Land-brücke aus Geröll und Sand zwischen beiden Felsmassiven.
Durch Kalkabbau (intensiv schon seit dem 15. Jh.) und Erosion
war das Witte Kliff im frühen 18. Jh. verschwunden. 1721 brach durch eine schwere Sturmflut auch die Landverbindung.
Seitdem schrumpfte der verbliebene Inselrest kontinuierlich. In
den 1930er Jahren war von ihm nicht viel mehr übrig als eine lang
gestreckte Sand- und Geröllbank
(siehe Kartenskizze unten).
Im Kontext des militärischen Projektes "Hummerschere" wurde die
Düne 1938 - 1941 durch Sandaufspülungen wieder vergrößert und
durch Buhnen und Molen befestigt. |
|
 |
| |
|
Bildquelle:
Kartenwerk Johannes Mejer (wikipedia), 1649 |
| |
Wegen der umfangreichen Sandüberdeckung ist
anstehendes Gestein auf der Düne nicht mehr anzutreffen. Wohl
aber werden lokale Muschelkalk- und Kreidegerölle
durch die Wellen ans Ufer - vor allem an den Nordstrand -
geworfen. Die Steine stammen sowohl aus dem einstigen
Abbau als auch aus der natürlichen Abrasion.
Farbvielfalt auf engem Raum:
blaugrauer Unterer Muschelkalk, gelblicher Mittlerer
Muschelkalk, weiße Kreide und roter Buntsandstein
(letzterer von der Hauptinsel stammend) |
|
 |
| |
 |
 |
 |
|
Bilder vom Nordstrand: Blick zur Hauptinsel (1)
und nach Nordosten (2), im Sand verstreut weiße Muschelkalk- und
Kreidegerölle (3) |
| |
| |
Helgoland ist eine wichtige Typlokalität der
deutschen Unterkreide. Etliche kreidezeitliche
Fossilien wurden erstmals aus Helgoländer Funden beschrieben.
Nachfolgend zunächst einige der
häufigeren Gesteinsfunde am Nordstrand der Düne
- aus einer privaten Sammlung:
|
 |
|
Während der Kreidezeit (vor 145 - 66 Mio. Jahren) kam es
nicht nur zu den uns vertrauten Ablagerungen weicher, weißer
Kreide. In den frühen Zeitabschnitten (Unterkreide) bestehen die
Ablagerungen überwiegend aus Tonsteinen und Sandsteinen
(hier Beispiel "Gault"-Geröll).
"Gault" (Gaultium) ist eine
veraltete Bezeichnung für eine Zeiteinheit der höheren
Unterkreide (heute: "Albium" und "Aptium").
Als "Blätterton" (Barrême)
werden dunkle, dünnblättrige, teerpappenartige Schiefertonsteine
beschrieben. Blätterton entstand unter anoxischen
(sauerstofffreien) Bedingungen.
Oft ist eine Hell-Dunkelschichtung erkennbar.
Die dünnen hellen Lagen
bestehen aus Coccolithen, die dickeren dunklen Lagen aus
feinsandig-schluffig-tonigem Material. |
 |
|
Ein lagiger grau-rötlicher Kalkstein
(Mittlerer Muschelkalk) weist rezente Bohrlöcher des
Borringelwurms auf (Polydora ciliata). Solcherart durchlöcherte
Kalksteine sind häufig anzutreffen.
Der gelbgraue Mittlere Muschelkalk (hier mit
undeutlichen Fossilresten) ist ein mergeliger Kalkstein, in den
rötlich-braune Mergeltone eingemengt sein können.
"Töck" ist die regionale Dialektbezeichnung für
den kreidezeitlichen Fischschiefer - ähnlich
dem Blätterton ein bitumenhaltiges, feingeschichtetes
Sedimentgestein, das einem sauerstoffarmen Ablagerungsmilieu
entstammt.
Es sind oft große, plattige Strandgerölle, die sich gemäß der
Schichtung gut aufspalten lassen und nicht selten Fischreste
enthalten. |

|
|
Der Helgoländer "Wellenkalk"
(im Bild vorne) des Unteren
Muschelkalks ist ein marin (im Flachmeer des germanischen
Beckens) abgelagerter hell- bis blaugrauer fester Kalkmergel. Er
ist dünnschichtig und zeigt eine unruhig wellige Struktur, die
auf fortdauernde Sedimentbewegung in einem einstigen
Kalkschlammwatt schließen lässt.
Weichgerundete Kreidegerölle kennen wir auch
aus dem Ostseeraum und von der südenglischen Kreideformation. Es
sind sehr feinkörnige, poröse, aus Kalkschlamm und
Kleinst-fossilien wie Coccolithen und Dinoflagellaten
entstandene Gesteine der Oberen Kreidezeit. |
 |
|
Die Krause Bohrmuschel (Zirfaea crispata) bohrt
in weichem Kalkstein, auch in Torf oder Ton, seltener in Holz -
und produziert dabei ansehnliche Löcher.
Faserkalk ist bekannt als faserig-kristalline
Kluftfüllung in eozänen Tuffen. Dass er hier in der Kreide
nachgewiesen wurde, ist eine Seltenheit.
Die kreidezeitlichen und die frühtertiären Feuersteine
sind überwiegend schwarz gefärbt. Unter Verwitterung werden sie
heller, durch Eisenoxyd können auch gelb-bräunliche
Farbvarianten auftreten. |
|
|
|
|
|
| |
| Im Museum auf Helgoland sind
viele der lokalen Fossilien ausgestellt - ein paar
Beispiele: |
 |
 |
 |
| div.
Fossilien aus der Oberkreide |
Ammoniten aus
der Unterkreide |
Belemniten
aus der Oberkreide |
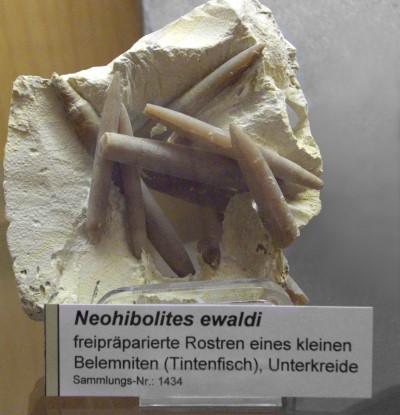 |
 |
 |
 |
|
Rostren e. Belemniten |
Rumpfskelett eines Fisches, im Töck |
Knochen div. Meeres-Saurier |
Ammonit Simbirskites sp. |
Literatur:
Hiltermann H. & Kemper E.: Vorkommen von Valangin, Hauterive und
Barrême auf Helgoland.
Ber. Naturhist. Gesell. Hannover 1969
Keupp H.: Die Blätterton-Fazies der nordwestdeutschen
Unterkreide. Ber. Naturhist. Gesell. Hannover 1979 |
| |
| |
| Der
Strand im Osten der Düne unterscheidet sich sehr
vom Sandstrand im Norden der Insel. Es ist ein langgezogener
Geröllstrand, die "Aade". Er bildete sich
strömungsbedingt als steinreiche Barre aus, seine mehr oder
weniger kontinuierlichen Aufschüttungen trugen und tragen dazu
bei, die Landfläche der Düne zu erhalten. Wie lange noch
angesichts des steigenden Meeresspiegels, bleibt abzuwarten. |
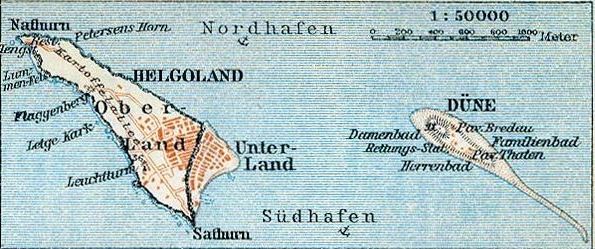
Helgoland und die Düne um 1910.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11139651 |
|
Die Aade reichte ursprünglich als südöstlicher Zipfel der
Düne weit ins Meer. Sie
war eine flexible, wandernde Landzunge, die das Geschiebe-material aufnahm, das
seit der postglazialen Überflutung des Gebietes freigespült und durch
Wasserbewegung und Strömungsrichtung zur Aade verfrachtet wurde.
Sie wanderte als Aufhäufung von Lockergestein (überwiegend
eiszeitliche Geschiebe und Sand) auf dem Felssockel der Insel.
Heute ist sie durch die Küstenschutzmaßnahmen rund um die Düne keine
bewegliche Landzunge mehr. Sie ist als Uferform weitgehend
„ruhiggestellt“, verändert allerdings weiterhin durchaus ihr
Masseaufkommen und ihre Begehbarkeit. |
|
|
|
|
Ein Auszug aus einer alten Beschreibung, 1903:
"... Der südöstliche, mehrere hundert Meter lange und nur wenige
Meter breite, bei Flut größtenteils vom Wasser überspülte Teil
der Düne stellt in seinem äußersten Ostende einen lediglich aus
gerundeten, flachen Geschieben zusammengesetzten Strandwall dar.
Sand fehlt in diesem Teil durchaus. Durch das Rauschen des
Wassers hindurch vernimmt das Ohr ein fortwährendes Klappern der
gegeneinander sich reibenden Steine. Ganz enorm herrschen die
Flintsteine vor. Nicht in den eigentümlichen bizarren Gestalten,
die alle denkbaren Formen annehmen und dem Laien versteinerte
Hände, Füße, Vogelköpfe u. dergl. mehr vortäuschen, sondern fast
ausnahmslos in Gestalt von Kugeln, Eiern, Linsen. Die Formen der
Flintsteine beweisen recht augenfällig, wie außerordentlich
stark die Flutwelle auf die Form eingewirkt hat, wie intensiv
die Zerstörung selbst des härtesten Gesteinsmaterials hier
gewesen ist..."
J. Petersen 1903: Untersuchungen über die krystallinen Geschiebe
von Sylt, Amrum und Helgoland in: Neues Jahrbuch für
Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Band 1; Band 1903 |
|
|
|
|
| |
|
|
Unser Interesse an
kristallinen Geröllen
lässt uns an diesem besonderen Geröllstrand verweilen.
Das Geröllsortiment besteht zum allergrößten Teil aus
kreidezeitlichem Flint, darunter sind auch die begehrten
Varianten des roten Helgoländer Feuersteins. |
| Die Helgoländer Düne ist Typlokalität für den roten Helgoländer Feuerstein.
Hier befindet sich das einzige bekannte Vorkommen.
Es handelt sich dabei um einen durch Eisenoxyd im Inneren kräftig braunrot
durchgefärbten Flint, der bereits in alter Zeit als
Schmuckstein Verwendung fand. Er erinnert zwar an roten
Jaspis, ist aber weniger durchscheinend. Das Besondere ist
zweifellos seine Hülle aus schwarzem Flint und weißer
opalisierter Kreide. Diese starken Farb- und
Helligkeitskontraste beeindrucken. |
| |
| |
 |
 |
|
| |
|
|
|
Für weitere Infos und Bildbeispiele siehe:
https://bude31.wixsite.com/bude31-helgoland
und:
https://de.wikipedia.org/wiki/Helgol%C3%A4nder_Feuerstein
|
|
| |
|
| Zwischen den sehr vielen Flintgeröllen der Aade finden sich auch gerundete oder schön abgeplattete Kristalline Geschiebe.
Sie stammen aus dem skandinavischen Raum
und sind Überbleibsel der saaleeiszeitlichen Moränen in der heute überfluteten Region
zwischen Schleswig-Holstein und Helgoland. Die
nähere Betrachtung lässt manches "Leitgeschiebe" erkennen, d.h. die
konkrete Herkunft kann aus dem Vergleich mit dem anstehenden Fels
in Norwegen, Schweden oder Finnland bestimmt werden. Der Anteil harter
Porphyre überwiegt, da sie der mechanischen Beanspruchung durch
das Abrollen am Geröllstrand besser Widerstand leisten können als ein
körniger Granit. Die hier abgebildeten Beispiele wurden auf Grund ihres
charakteristischen, gut wiedererkennbaren Gefüges ausgewählt. Dazu
gehören vor allem die Gesteine von den
Åland-Inseln, Porphyre aus Dalarna,
Småland-Hälleflinten und Rhombenporphyre aus dem Oslo-Gebiet.
|
| |
| Die
kleinen Steine wurden vor
dem Fotografieren genässt, um ihr Gefüge etwas deutlicher zu zeigen. |
|
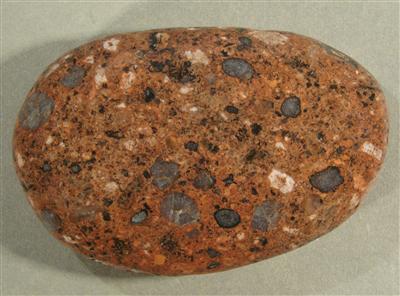 |
 |
 |
 |
|
Åland-Quarzporphyr,
6,5 x 4,5 cm |
Ringquarzporphyr,
6,5 x 5 cm |
Åland-Quarzporphyr, 6 x 4,5 |
Åland-Quarzporphyr,
7 x 5 cm |
 |
 |
 |
 |
|
baltischer Granitporphyr, 5 x 5 |
Åland-Porphyraplit,
6,5 x 3,5 cm |
Åland-Rapakivi,
5,5 x 3,5 cm |
porphyrischer Rapakivi, 4 x 4 |
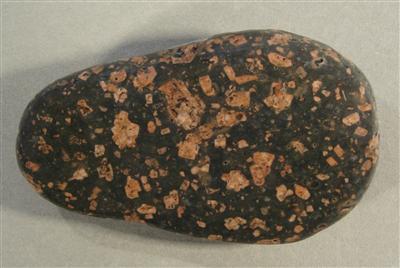 |
 |
 |
 |
|
Bottnischer Quarzporphyr, 7,5 x 4 |
Särna-Quarzporhyr, 6 x 6 |
roter Särna-Quarzporhyr, 8 x 5 |
Dalarne-Porphyr, 6,5 x 5,5 |
 |
 |
 |
 |
|
Dalarne-Feldspatporphyr, 4,5 x 4 |
Vasselbodarna-Porphyr,
5 x 4 |
Bredvad-Porphyr, 5 x 4 cm |
Dala-Feldspatporphyr, 5 x 4 |
 |
 |
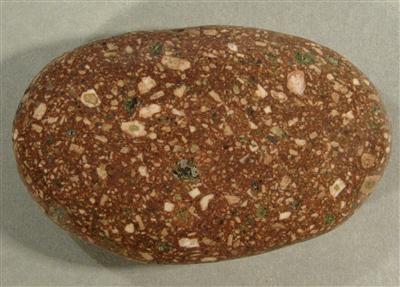 |
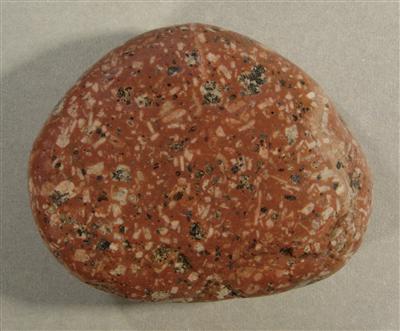 |
|
dunkler Särna-Porphyr, 5,5 x 4,5 |
einsprenglingsreicher
Porphyr |
roter Dala-Porphyr,
6,5 x 4 |
Grönklitt-Porphyr, 6,5 x 5,5 |
 |
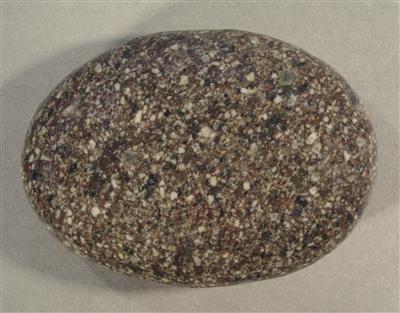 |
 |
 |
|
bunter Dala-Porphyrit, 8 x 5,5 |
feinkörn. Venjan-Porphyrit,
8 x 6 |
Älvdalen-Porphyr, 5,5 x 4,5 |
Älvdalen-Ignimbrit, 5,5 x 4 |
 |
 |
 |
 |
|
brauner Porphyr, 7,5 x 7 |
Ostsee-Quarzporphyr,
5,5 x 4,5 |
Ostsee-Quarzporphyr,
5,5 x 4,5 |
Ostsmåland-Porphyr,
8,5 x 5 cm |
 |
 |
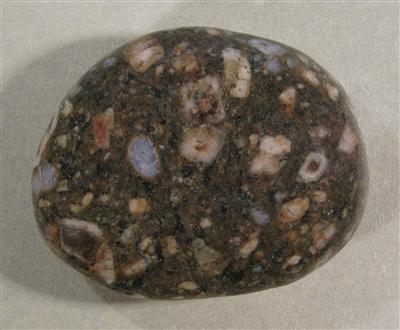 |
 |
|
Quarzporphyr, 5 x 3,5 cm |
Emarp-Porphyr, 8 x 6 cm |
Blauquarzporphyr, 5,5 x 4,5 |
Småland-Porphyr,
8 x 6 cm |
 |
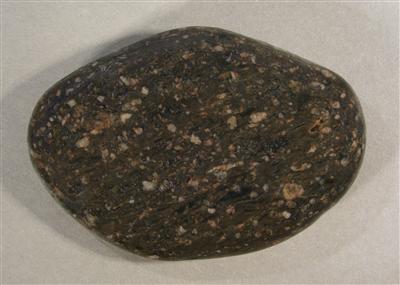 |
 |
 |
|
Småland-Hälleflint,
6,5 x 5 cm |
Småland-Hälleflint,
9 x 6 cm |
Småland-Hälleflint,
4,5 x 3 cm |
schlieriger Porphyr,
8,5 x 6,5 cm |
 |
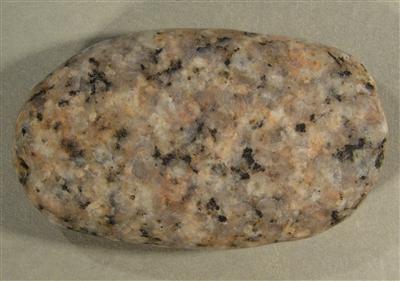 |
 |
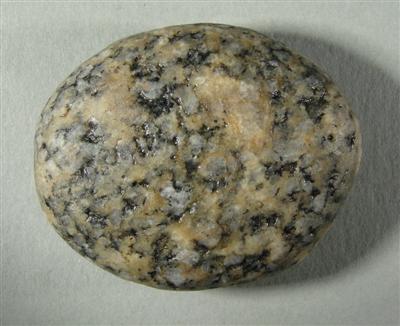 |
|
Hälleflint, 6,5 x 5 |
Småland-Granit,
6,5 x 4 cm |
Granit, 7 x 5 cm |
Småland-Granodiorit,
4,5 x 4 |
 |
 |
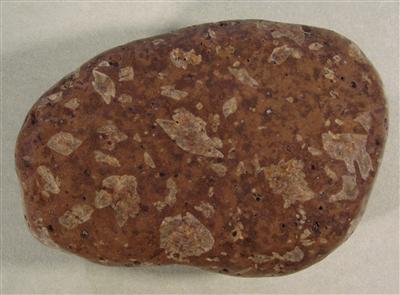 |
 |
|
ostbaltischer Granit, 4,5 x 4,5 |
porphyrischer Granit, 6,5 x 4,5 |
Rhombenporphyr, 9 x 6 cm |
Rhombenporphyr, 7 x 5 cm |
 |
 |
 |
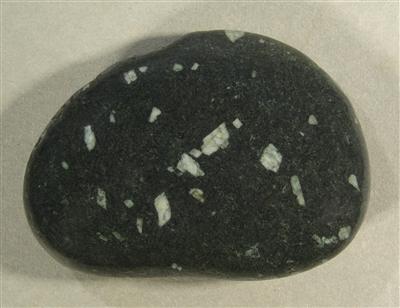 |
|
Rhombenporphyr, 10 x 8 cm |
Oslo-Syenitporphyr, 8 x 5,5 |
Tønsbergit,
4 x 3,5 cm |
Diabas, 6 x 4 cm |
 |
 |
 |
 |
|
feinkörniger Syenit, 7,5 x 6 |
quarzreicher Granit, 6 x 4 cm |
Leukogranit, 5,5 x 6 cm |
Granodiorit, 5 x 5 cm |
|
|
|
|
|
Manche großkalibrigen Steine des Küstenschutzes
laden zu Gefügestudien ein - hier ein kleinkörniger Granit mit
einem schönen Pegmatit-Gang.
Es wurden allerdings (neben Tetrapoden) vorzugsweise glatte
schwere Natur-steine (Basalt) oder Metallhüttenschlacken
eingesetzt, z. B. Kupferschlacke (CUS) der
Norddeutschen Affinerie HH. Obwohl ökologisch nicht
unbedenklich, wird sie verwendet, weil sie eine hohe
Gesteinsdichte (Gewicht) aufweist und äußerst
verwitterungsresistent ist. Auf der Düne kann man sie in Buhnen
eingesetzt finden. |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
So bekommt, wer um die Düne wandert, trotz der Kleinräumigkeit recht
unterschiedliche Strandeindrücke:
Uferbefestigung und „Hafenmilieu“ auf der
Westseite - Badefreuden am Sandstrand im Norden und im Süden - hier und
dort nah am Wasser die Robbenkolonien...
und im Osten der klingende, in den Brandungswellen rieselnde
Geröllstrand. |
|
|
|
|
|
Weitergehende Informationen zu den Kristallinen Geschieben /
Leitgeschieben sind in der digitalen Referenzdatei
http://www.skan-kristallin.de/
sowie auf dieser Website unter
http://www.strand-und-steine.de/gesteine/gesteine.htm
zu finden.
Ausführlich Informationen zum Helgoländer Feuerstein auch unter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Helgol%C3%A4nder_Feuerstein
|
|
|