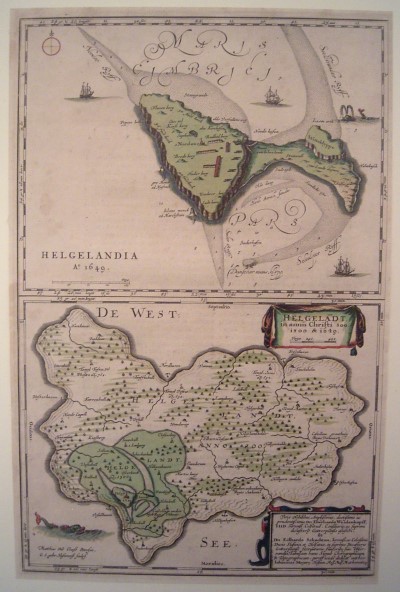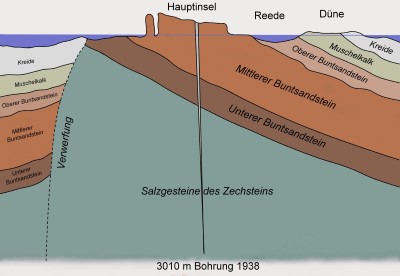Landschaft - Geologische Fenster - Helgoland
Helgoland | Liether Kalkgrube
|
Kalkberg Segeberg |
Morsum Kliff
| Lägerdorfer Kreidegruben
Die Felseninsel Helgoland
mit der "Düne"




Ein Besuch auf dieser exponierten Felseninsel
vermittelt eine Fülle unterschiedlichster, möglicherweise tief
berührender Eindrücke - vorausgesetzt man geht nicht nur auf eintägige
Shopping-Tour, sondern hat die Möglichkeit, mit Muße und Naturliebe
abseitigere Winkel und ungewöhnlichere Zeiten zu wählen.




| |
Stellen Sie sich Helgoland nicht von Wasser umgeben, sondern inmitten
einer weiten flachwelligen Landschaft vor, als gewaltiges, hoch
aufragendes
Felsmassiv… - so war es noch bis vor rund 4000 Jahren. Damals lag die
Doggerbank noch nicht unter Wasser. In der Eiszeit hatte der
Meeresspiegel global mehr als 100 m tiefer gelegen, auf Grund
der in Form von Eis gebundenen Wassermassen. Nacheiszeitlich
stieg der Meeresspiegel - bis zum heutigen
Niveau.
Es ist nachzuvollziehen, dass ein solch herausragender Ort die in
weitem Umkreis lebenden Menschen veranlasste, ihn für besondere Anlässe
und Rituale aufzusuchen:
„Helge Landt“ = Heiliges Land. Der ganze Fels - ein großer Opferaltar,
er soll dem germanischen Gott Fosite geweiht gewesen sein.
|
|
Wasser ist für alle Lebens- und Entwicklungsprozesse auf der Erde von
elementarer Bedeutung. Auch für das Entstehen und Vergehen von
Gesteinen.
Aus der Wirksamkeit von Wasser ist Helgoland im Lauf von Millionen
Jahren entstanden, aus der Wirksamkeit des Wassers wird es ganz sicher in (ferner)
Zukunft wieder verschwinden.




| Salzhaltiges Wasser führte im Erdmittelalter zu mächtigen Salz- und
Gipsablagerungen - in einem weiten Senkungs-gebiet, das sich
zwischen den Shetlands im Westen und Polen im Osten erstreckte.
|
Ebenfalls Wasser führte später über Millionen
von Jahren sedimentreiche Fracht aus den umliegenden verwitternden
Gebirgen in dieses dauerhafte Senkungsbecken und ließ Salze, Kalke und
Gips unter immer neuen, beständig anwach-senden
Sedimentschichten verschwinden - die sich zu Muschelkalk, Buntsandstein,
Kreide und späteren tertiären Gesteinen verfestigten. Unter
dem Druck dieser bis 10 km mächtigen auflagernden Gesteinsschichten gerieten die
weicheren, plastischen Salze und Gipse in der Tiefe in Bewegung und
drängten, wo tief reichende Bruchzonen es erlaubten, nach oben - und
sie beförderten dadurch einiges
ans Licht, was heute fremd in der norddeutschen Landschaft dasteht.
Helgoland ist auf diese Weise emporgehobenes Land. Der einst in rund
3000 m Tiefe lagernde Bundsandstein ragt nun als einsame
Felseninsel hoch aus dem Meer.
|
| |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Und ist dadurch exponiert, dem Wetter und dem Wellenschlag ausgesetzt.
Der weiche, tonige Buntsandstein hat Ähnlichkeit mit dem roten,
ebenfalls weichen Sandstein des Grand Canyon. An diesen Felsen lässt
sich anschauen, was Verwitterung ist und tut.
Wiederum wirkt also das Wasser - jetzt erodierend,
lösend und abtragend. |
| |
 |
 |
 |
 |
|
verwitternder
Buntsandstein |
zerklüfteter Fels |
heraus präparierte Schichtung |
Schutthalde am geschützten Fuß |
| |
Wir schauen uns das Gestein des Helgoländer
Felsens etwas genauer an.
Ein erster Eindruck ist die ausgeprägte Schichtung des
Buntsandsteins - und seine Schrägstellung. Sie
beträgt ca. 200 und geht auf den salztektonischen
Aufwölbungsprozess zurück.
Bei der Aufbeulung wurden die aufliegenden Schichten durch eine
Verwerfung zerteilt (mit einem Verwerfungsbetrag von mehr als
1000 m). Das führte dazu, dass an der Verwerfungslinie der
Untere Buntsandstein und die Kreide auf gleicher Höhe zu liegen
kommen. Zusätzlich erfolgte eine Aufschiebung des
Zechsteinsalzes, eine Schichtverdoppelung, die mit dann mehr als
3000 m Salzgestein die enorme Hebung des Inselplateaus bewirkte. |
| |
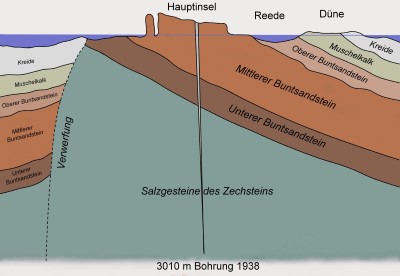 |
 |
 |
| Geologischer Schnitt des
Untergrundes (vereinfacht) |
Die Westfront von Süden |
am Medelst Hörn |
| |
|
Der im Helgoländer Felsen
anstehende Mittlere Buntsandstein besteht aus tonigen
Sandsteinschichten (farblich zwischen hellviolett und
dunkelbraunrot) im Wechsel mit hellem, mürbem "Katersand".
Letzterer ist ein weißlicher, kalkhaltiger und lockerer
(bröseliger) Sandstein.
Diese Streifung ist Helgolands Charakteristikum.
An der Basis sichtbar ist die Volpriehausen-Folge mit
dunkelrotem, festem Sandstein, darüber folgen die Untere und
Obere Detfurth-Folge mit feingeschichteten sandigen und tonigen
Lagen. Neben den Katersanden treten im höheren Teil der Detfurth-Folge
auch hell-grünlich-graue Lagen auf, die durch Ausbleichung der
roten Tonsandsteine entstanden sind.
Nachfolgende Detailbilder des Gesteins im Licht der
aufgehenden Sonne, besonders farbintensiv... |
|
 |
| |
Während der Ablagerungsepoche der
Buntsandstein-Sedimente befand sich der damalige deutsche Raum
(eingebettet in den Superkontinent Pangäa) auf seiner
Kontinentaldrift noch erheblich weiter südlich, in einer
kontinental trocken-heißen Zone (Wüstenklima). Insgesamt war das
globale Klima heißer als heute, die Pole eisfrei.
In dem großen norddeutschen Senkungsgebiet (s. o.) lagerten sich
in weit verzweigten Flusssystemen und flachen Binnenseen Sande,
Schluff und Ton ab, herangetragen aus umliegenden Gebirgen. Auch
äolische Ablagerungen (Flugsanddünen) entstanden. Heute zeigt
die Kalahari in Südafrika geologisch ähnliche Gegebenheiten.
Die Rotfärbung des Sandes wird durch oxydiertes Eisen
verursacht. |
| |
Mit etwas Glück kann man am Fels einigen für den
Buntsandstein typischen Strukturen begegnen:
Strömungsrippel werden im sandigen Sediment vom
fließenden Wasser hervorgerufen. In sedimentären Gesteinen sind
sie ein Beleg für ein früheres Gewässer.
Belastungsmarken entstehen an Schichtgrenzen,
wobei die obere überlagernde Schicht dichter als die meist feuchtere
und feinere, untere ist. Im Querschnitt bestehen die Strukturen aus einer
Abfolge aus ineinandergreifenden Zungen und Loben.
Der Helgoländer Buntsandstein ist (in unterschiedlichem Maß)
kalkhaltig. Häufig treten helle kalkreiche Linsen auf.
Auslösungsprozesse lassen in ihnen kleine Höhlungen
entstehen, die dann Raum für die Ausbildung von
Calcit-Kristallen bieten.
Die Wabenverwitterung geht ebenfalls auf
Lösungsvorgänge im Gestein zurück. Dabei führt die
Wiederverfestigung der gelösten Substanzen zu weichen, gitter-
oder wabenartigen Mustern. |
 |
 |
 |
 |
| Strömungsrippeln |
Belastungsmarken |
kalkreiche
Linsen |
Wabenverwitterung |
| |
| Bilder aus einer kleinen, privaten, zeitweise in
einem Schulfoyer gezeigten
Helgoland-Sammlung veranschaulichen einige Details im
Buntsandstein: |
 |
 |
 |
| Calcitdrusen und
Bleichhof ("Fischauge") |
Rippelmarken und eine "Coelestin"-Druse
(Baryt) |
Trocknungsrisse und etwas
Malachit |
| |
| |
Buntsandstein ist arm an
Fossilien. Auch Mineralien (außer Calcit & Co.) treten nur
wenige und spärlich auf. Anders das Kupfererz.
Kupfer im Helgoländer
Buntsandstein:
"Insbesondere zeigt der rote bis rotbraune, glimmerreiche, bald
stark, bald weniger tonige mittlere Buntsandstein die Kupfererze
in relativ großen Mengen in engster kausaler Verkettung mit
graugrünen Verfärbungszonen. Die Analysen des Buntsandsteins
ergeben wechselnde Gehalte des Kupfers, je nachdem man eine
besonders reiche Partie fasst."
(R. Schreiter 1930) |
Auf dem Meeresboden in der nahen Umgebung Helgolands wurden in
den 1960er und 1970er Jahren verhüttete Kupferbarren in Form
großer runder Scheiben gefunden. Ihre Datierung ergab
wikingerzeitliches Alter.
Im Museum Helgoland sind die nachfolgenden Exponate ausgestellt: Kupfererz im
Buntsandstein, Kupferbarren, Kupfer-Gußkuchen, Schlacke. |
 |
 |
 |
 |
 |

Kupfer-Gußkuchen galten als
Zahlungsmittel der Wikinger |

Verhüttungsschlacke aus der
Kupfer-Verarbeitung |
|
|
Überhaupt kann der Besuch des kleinen Heimatmuseums empfohlen
werden. Es bietet viel Sehenswertes und viele Informationen und
Ausstellungsstücke zur Entstehung, zur Naturkunde und
Lokalgeschichte der Insel.
Beispielsweise zeigt das
Relief sehr gut die Ausmaße des unter Wasser liegenden
Felssockels der beiden Inseln,
der bei Niedrigwasser
teilweise trocken fällt.
Und zur Lokalgeschichte gehört auch das
Lebens-ABC des Helgoländers James
Krüss.
|
 |
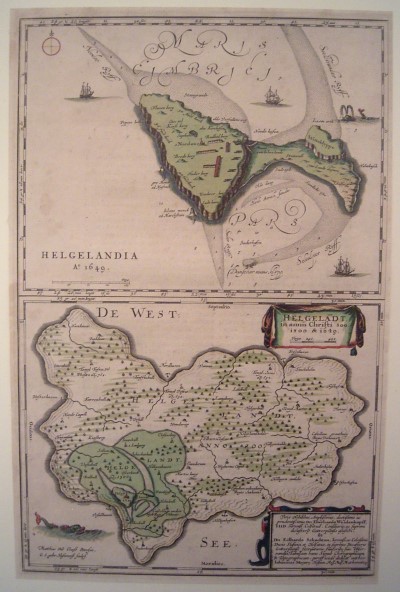 |
 |
 |
 |
|
(Bilder von 2007) |
|
|
Ein Aufräumen in alten Familienfotos brachte das nebenstehende
Bild zum Vorschein - Helgoland im Jahr 1934,
noch mit ursprünglicher Silhouette,
vor dem "Big Bang" (1947), als die Südspitze der Insel
weggesprengt wurde.
Diese gewaltige Sprengung hinterließ vielfältige, große
Zerstörungen.
Infos z. B. unter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprengung_von_Bunkeranlagen_auf_Helgoland
|
|
 |
|
|
|
|
|
Eine andere Welt als es die Felseninsel ist, erlebt man, wenn man mit der kleinen Fähre zur
Düne
fährt...
Auch hier hilft ein Blick in die Erdgeschichte, um besser zu verstehen. |
|
|
|
|
|
|
Über Helgoland gibt es jede Menge lesenswerte Literatur
- eine kleine Auswahl hier zum Thema Geologie:
Fraedrich, Wolfgang: Felseninsel Helgoland, Springer 2022
Meyn, Ludwig: Zur Geologie der Insel Helgoland, Kiel 1864
Schulz, H. D.: Die Kupferverhüttung auf Helgoland zur
Wikingerzeit. Umschau 79 (1979)
Spaeth, Christian: Zur Geologie der Insel Helgoland in: Die
Küste 49 (1990), 1 - 32.
Ausgewählte Links:
https://de.wikipedia.org/wiki/Helgoland
https://epic.awi.de/id/eprint/27310/1/Hns1980a.pdf
https://www.steinkern.de/fundorte/sonstige-bundeslaender/1110-fossilien-von-der-insel-helgoland.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinkiste_von_Helgoland
Luftaufnahmen zeigen gut die exponierte Lage der Insel, z.B. auf
der Seite
http://www.walz-naturfoto.de/galerie_ausgabe.php?sw1=helgoland&vk1=und&sw2=luftaufnahme&vk2=und&sw3=&thumbs=24&seite=1
(Luftaufnahmen) u. a.
|