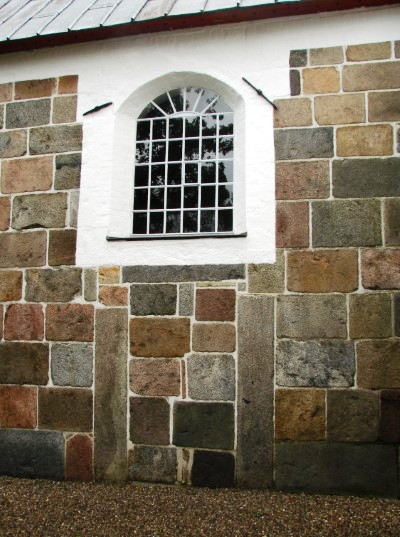Westschweden |
Südwestschweden | Südschweden
|
Bornholm |
Südnorwegen |
Nordjütland
Romanische Quaderkirchen in Nordjütland
Einführender Hinweis:
Der gängige Begriff "Granitquaderkirche" ist
irreführend und wird hier deshalb vermieden,
denn nur etwa ein Viertel der in
einer mittelalterlichen Findlingskirche verbauten Feldsteine,
ob gequadert oder nicht, sind tatsächlich Granite - im
gesteinskundlichen (petrographischen) Sinne. Die Bezeichnung
"Granit" wird gemeinhin summa summarum für sämtliche körnigen,
kristallinen Gesteine verwendet. Neben Graniten finden wir in
den Kirchenmauern aber auch andere Tiefen-gesteine, vielfach Gneise,
daneben auch Sandstein, Kalkstein, Quarzite
... |
| |
| Die Verbreitung des Christentums in Dänemark ab der 2.
Hälfte des 10. Jh. brachte neben neuen sakralen Bildmotiven
(beispielsweise in Runensteinen) den romanischen Kirchenbau ins Land,
zunächst mit Schwerpunkten um den alten Handelsort und späteren
Bischofssitz Ribe (Südjütland) und die beiden
anderen christlichen Hauptorte: Roskilde (Sjælland)
und Aarhus (Nordjütland). Aber auch um den Limfjord,
insbesondere auf Mors und auf Salling, wurden sehr viele Kirchen
errichtet. |
| |
Da der neue Glaube vom König (von Harald Blauzahn an) und
seinen Gefolgsleuten übernommen und befördert wurde, entstan-den
viele der heute ländlich abseits liegenden Kirchen nicht nur in
damaligen Verwaltungszentren, sondern auch im Kontext von
Herrenhöfen. Der führenden Schicht war es möglich und ein
Anliegen, auf ihren Herrensitzen mit gediegenen Kirchenbauten
auf diese Weise ein bekennendes Zeichen zu setzen, sichtbar den
(christlichen) Fortschritt zu vertreten.
Die ersten Kirchen waren zwar oftmals Holzbauten, vermutlich
Stabkirchen, sie wurden jedoch wegen vieler Brandereignisse
bald durch Steinkirchen ersetzt.
Quaderkirche in Sahl (um 1150),
sie war einst Hauptkirche der Ginding Harde. |
|
 |
|
|
 |
|
Aus der Zeit ab ca. 1100 datiert eine große Zahl von wehrhaften und zugleich
sehr ansehnlichen Feldstein-Quaderkirchen.
Von Anfang an wurde die aufwen-dige Bauweise mit sorgfältig
behauenen Steinquadern bevorzugt - anders als in vielen
ländlichen Regionen im norddeutschen Raum, wo frühe romanische
Kirchen vor allem aus nicht oder wenig bearbeiteten Lesesteinen
errichtet wurden (Feldsteinkirchen). Es mag aber auch die
Verfügbarkeit an ausreichend großen bearbeitungsfähigen
Geschieben im Lande eine Rolle gespielt haben. Darüberhinaus
gibt es Hinweise, dass im jütischen Raum in späterer Zeit
Steinbruchware aus Westschweden in Anwendung kam (Bohus-Granit).
(Meyer 2010)
Quadermauerwerk an der Kirche zu Åsted
|
|
| |
| |
|
Einige wenige Beispiele: |
 |
|
Die Kirche von
Åsted,
Nordsalling (südlich von Fur) wurde als schlichte turmlose
Saalkirche in solider Quaderbauweise in der
ersten Hälfte des 12. Jh. errichtet. Sie war Hauskirche des
mittelalterlichen Herrenhofes
Østergaard (https://middelalderborgen-oestergaard.dk/).
Im 15. Jh. wurden der Turm und die Vorhalle (Ziegelmauerwerk
über Feld-steinquadersockel) hinzugefügt und im 16. Jh. zwei
Querbauten: eine geräumige Vorhalle auf der Südseite
(2. Bild unten) und eine
Grabkapelle mit gestaffeltem Giebel
auf der Nordseite
(siehe Gesamtbild links).
|
 |
 |
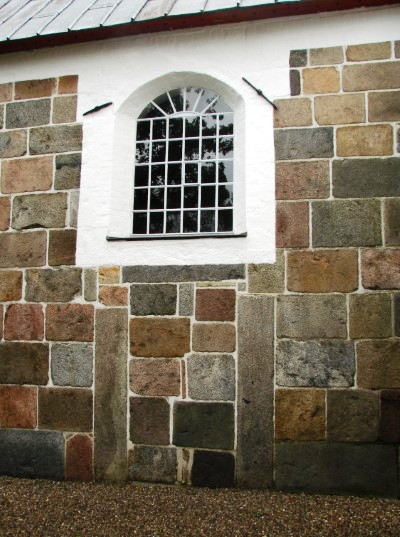 |
 |
Feldsteinquader des Chores
|
Mischbauweise (Ziegel
über Feldsteinquadern) am jüngeren Querbau, Südseite |
im 17.Jh. eingefügte
große Fenster
|
die bunte Vielfalt der
überwiegend westschwedischen kristallinen Geschiebe
(mit nur 2 Graniten!) |
|
|
|
|
 |
|
Die ursprünglich romanische Kirche von
Kollerup (bei
Fjerritslev)wurde in der Spätgotik kräftig überbaut. Davon
zeugen der West-Turm,
der Chor und der Langhausausbau mit einem Kreuzgratgewöl-be. Der
auf dem Bild zu sehende Vorbau (Südseite) stammt aus dem 16. Jh.
(gestaffelter Giebel), ebenso eine Kapelle an der Nordseite.
Der Blick auf den Chor (unten 1. Bild) gibt das prachtvolle
Quader-mauerwerk wieder. Im Bereich des gotisch ergänzten Chores
wurde auf einem Feldsteinsockel aufgebaut, mit großen Quadern im
unteren Bereich und kleineren in der Höhe. Die Mauer des alten
Teils fußt auf einem Quadersockel mit abgeschrägter Fase. |
 |
 |
 |
 |
Das Gesteinssortiment des
Chores (und somit seine einheitlich rötliche Optik)
entspricht nicht der sonst üblichen Buntheit eines Feldsteinmauerwerks
(siehe
Kirche zu
Åsted).
Die Quadermauer enthält einen hohen Anteil an feinkörni-
gem Bohus-Granit - mutmaßlich Steinbruchware
aus Westschweden. |
Langhaus und
Chor mit Kreuzgrat-
gewölbe.
|
Viele der Kirchen haben noch
ihr altes, romanisches Granit-Taufbecken |
|
|
|
|
 |
 |
|
Die Kirche von
Smollerup bei Mønsted wurde Anfang des 12. Jh.
errichtet und in gotischer Zeit durch den
Turm und eine Vorhalle auf der Südseite ergänzt.
Die Kirche von Smollerup gehörte einst wie das Herrenhaus Smollerupgård
dem Viborger Domkapitel an. Das Herrenhaus ist nicht mehr vorhanden.
In der Kirche zu Smollerup befindet sich die älteste Glocke Dänemarks.
siehe auch die
Infotafel an
der Kirche |
Der Variantenreichtum der Quadergesteine in den Kirchenwänden
lädt zu Studien ein: was hat sich hier an Gesteins-arten
versammelt, sind "Leitgeschiebe" darunter? Bestimmbare
Leitgeschiebe sind in der Tat häufig Granite.
Beispiele: |
 |
 |
 |
 |
 |
Lardalit, Typ
Gjone,
LG Oslo-Gebiet, N |
Kristinehamn-Granit,
LG Värmland, S |
Bohuslän-Granit,
LG Westschweden |
Larvikit, LG
südwestl.
Oslo-Gebiet |
unbestimmter,
deformierter Granit |
| |
| Anders als der vergleichsweise leicht zu
bearbeitende Sand- oder Kalkstein bedeuteten kristalline
Findlingsgesteine wie Granit & Co. eine große Herausforderung an
Kraft, Geschicklichkeit und Erfahrung der Steinmetze. In
romanischer Zeit wurde die Verwendung des Flächenbeils
("Fläche") mit einer etwa 10 cm breiten Schneide entwickelt -
ein schweres Werkzeug mit Eschenstiel und geschmiedetem Kopf.
Damit konnte, in wechselnder Richtung vorgegangen, die
Quader-fläche geglättet werden - nachdem mit
Schlegel und Meißel vorgearbeitet worden war. Die Maße der zu
verbauenden Quader waren nicht festgelegt (siehe z. B.
Detailbilder der Kirche zu
Åsted),
sie richteten sich nach den Anforderungen des Baus und nach dem
vorhandenen Findlingsmaterial. |
| |
| In der Anfangszeit der Christianisierung wurde
der Bau neuer Kirchen von den jeweils missionierenden Klöstern
aus durchgeführt. Später entstanden Klosterbaubruderschaften,
Gruppen von baukundigen Mönchen und ausgebildeten Laienbrüdern,
die von Kirchenbau-Ort zu Kirchenbau-Ort reisten. So kam es
dazu, dass auch Motive, Stilmerkmale oder dekorative Elemente am
Bau regional oder überregional "auf Wanderschaft" gingen und
weitere Verbreitung fanden. |
| |
 |
|
Ein interessantes und zugleich rätselhaftes Beispiel dafür
sind die
Schachbrettsteine in den nordjütischen
romanischen Kirchen.
Sie sind ein von den Steinmetzen an ihren Arbeitsstätten
hinterlassenes Bildmotiv - nicht nur in Nordjütland,
sondern auch in Ostdeutschland und Westpolen. B. Dittmar(*)
gibt eine umfassende Überschau des bekannten Bestandes. In
Dänemark sind es rund 50 Kirchen, in einem breiten Streifen
zwischen Thy und Aarhus. Dabei tritt ein solcher Stein in der
jeweiligen Kirche meist nur einmal auf, an einer beliebig
anmutenden Stelle, häufig im Eingangsbereich. Es ist also kein
schmückendes Element, sondern es hat allein durch sein einmaliges
Dasein eine besondere Aussagekraft. |
Die Kirchenbaukunst wurde im Zuge der
Christianisierung aus dem deutschen Raum in den dänischen Norden
gebracht - es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass das
Schachbrettmotiv damals bereits mitgebracht wurde. Es scheint eine original nordjütische Bild-Botschaft des 12. Jh. zu
sein
- die dann im 13. Jh. auch im Osten (vermutlich durch dort
tätige jütländische Baumeister) auftritt. Was will dieses
Schachbrett uns sagen? Da keine schriftlichen Hinweise aus der
Entstehungszeit bekannt sind, bleiben Fragen.
Dass die Steinmetze mit diesem - mittels
zweierlei Bearbeitungstechniken der Oberfläche gestalteten
- Stein ein Zeichen ihrer Kunst, ein Markenzeichen, ein
Sigel setzten (wie als Vermutung geäußert)... möglich. Aber eher
von späterer Denkweise aus zurück gedacht. Angesichts der nicht
rational abstrakten, sondern noch stark mythologisch-religiösen
Weltsicht und Gemütslage des frühen Mittelalters scheint mir (die uns heute
wiederum eher fremd anmuten-de) Deutung des "eingemauerten
Schachspiels des Teufels" ausgesprochen plausibel. Zitat aus
Dittmar (s. u.): "Eine Deutung des Schachbrettmusters ist
die des eingemauerten Schachspiels des Teufels, einer in
Dänemark bekannten Sage. Der Teufel spielte mit Gott um den
Kirchenbau oder um die armen Seelen und verlor die Partie und
das Brett. Zum Gedenken an den glücklichen Ausgang des Spieles
hat man das Schachbrett eingemauert. Somit kann der
Schachbrettstein für die Gläubigen eine Schutz- und
Abwehrfunktion gehabt haben." |
|
|
| Zwei Beispiele der zahlreichen dänischen
Kirchen mit Schachbrettsteinen: |
Grønning
Auch die Grønninger Kirche entstand im 12.Jh. als kleiner
Saalbau mit Chor und Apsis (letztere ist hier erhalten
geblieben) und - wie regional üblich - in Quaderbauweise über
einem abgeschrägten Sockel. In gotischer Zeit wurden Westturm
und südliche Vorhalle angebaut. Dadurch befindet sich seitdem
das mit Säulen und Tympanon geschmückte, ursprüngliche
Eingangsportal in dieser Vorhalle. Das Tympanonrelief zeigt ein
löwenartiges Tier (3. Bild
unten).
In der Wandecke links vom Portal befindet sich der
Schachbrettstein (2. Bild).
Bild rechts aus Wikipedia: Hideko Bondesen
- http://www.nordenskirker.dk/ |
|
 |
| |
| Sahl |
 |
|
Die Kirche von Sahl
(Viborg Kommune) stammt von der Mitte des 12. Jh. Wie üblich
existierte ursprüng-lich nur das balkengedeckte Langhaus und der
Chor. Erst im 19. Jh. kam der Ziegelbau der Vorhalle hinzu. Die
Kirche hat kein Westturm - dafür einen Dach-reiter, der die
Glocke beherbergt. So ist das schöne Gebäude seinem historischen
Erscheinungsbild nahe geblieben. Auch die Fenster wurden nicht
durch größere ersetzt - wie es sonst für mehr Raumhelle
spätestens ab dem 16. Jh. gerne geschah.
Die Kirche war dem Rittergut zu Ormstrup zugehörig.
|
 |
 |
 |
sehr sorgsam gearbeitete
Quader
|
Der Schachbrettstein in
der Südwand der Kirche
|
Die Helligkeitsunterschiede im
Stein ent-
standen während der Oberflächenbearbei-
tung (stocken) und schufen frische neben
alten Oberflächen. |
| |
| |
|
|