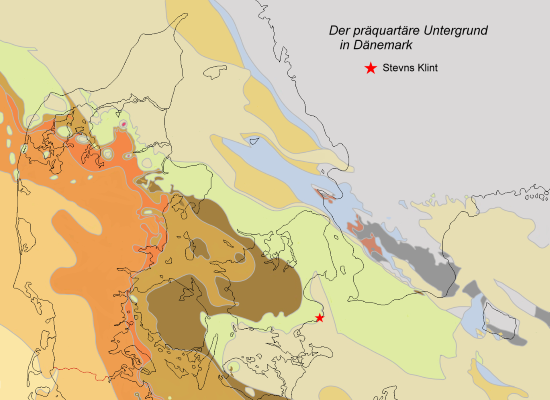Westschweden |
Südwestschweden | Südschweden
|
Bornholm |
Südnorwegen |
Nordjütland
Stevns Klint auf Sjælland
Stevns Klint ist ein etwa 16 km langes, gut
40 m hohes Kalksteinkliff an der Südost-küste von Sjælland.
Auf Grund der vorliegenden Schichtung - weicher
Kreidekalk unter härterem Bryo-zoenkalk - sorgt die
Abrasion dafür, dass ein leicht überhängendes Profil entsteht
und sich kaum Strand ausbilden kann.
So steigt die weiße Felsformation ziemlich unvermittelt aus dem
Meer auf - in ihrer ganzen Länge. Ein nahezu
mediterran anmutender Anblick - allerdings als
Panorama nur vom Boot aus zu erleben.
Bei der alten, bereits teilweise abgestürzten Kirche von Højerup
wurde mittels einer Treppe eine Abstiegsmöglichkeit geschaffen.
Sie wird gerne genutzt, denn aus dem niederbrechenden
Kreidegestein können Fossilien gefunden werden -
Belemniten, Seeigel, Muscheln...
Auch Geologen suchten zu wissenschaftlichen Zwecken den Zugang
zum Kliffgestein - und wurden in besonderer Hinsicht
fündig... |
|
 |
| |
|
|
|
Die untere Schicht des Kliffs - Schreibkreide (Maastrichtium, 72 - 66 Mio. Jahre) -
wird durch eine dünne, aber höchst bemerkenswerte Lage aus einem
dunklen Ton von dem darüber liegenden frühtertiären Bryozoenkalk
(Danium, 66 - 61 Mio. Jahre) getrennt. Dieser Ton war als "fiskeleret
(Fischton) wegen enthaltener Fisch-Fossilien zwar schon
beschrieben, hatte darüber hinaus aber kaum Bedeutung gehabt.
Das änderte sich, als im Jahr 1980 amerikanische Wissenschaftler
anhand von Gesteinsanalysen an zwei Orten der Erde (in Gubbio,
Italien und am Stevns Klint) eine unerklärlich stark
erhöhte Konzentration von Iridium nachweisen konn-ten.
Iridium ist ein auf der Erde äußerst seltenes, im Weltraumstaub
und in Asteroiden bzw. Meteoriten jedoch in hohen Anteilen auftretendes Edelmetall.
Die Konzentration in Gubbio war 30mal höher als für die Erde
normal, im Fischton von Stevns Klint sogar 160mal. Die
betreffenden Gesteinsschichten (desgleichen entsprechende,
später an anderen Fund-orten untersuchte) gehören derselben
Entstehungszeit an - vor etwa 66 Mio. Jahren. Auf Grund
dieser sehr ungewöhn-lichen Iridium-Anomalie wurde die These eines einmaligen großen,
kosmischen Ereignisses, eines gewaltigen Asteroiden-Einschlags
formuliert, der seine extraterristrische Fracht damals weltweit
verbreitete - mit global verheerenden Aus-wirkungen.
Es wird dabei von einem Asteroiden mit einem Durchmesser von 10
- 12 km ausgegangen.
"Der Staub verhinderte mehrere Jahre lang, dass das Sonnenlicht
die Erdoberfläche erreichte. Dieser Lichtverlust unterdrückte
die Fotosynthese und als Konsequenz kollabierten die meisten
Nahrungsketten und ein Massenaussterben folgte." (Alvarez et al.
1980) Das schlagartige Verschwinden der Dinosaurier sowie
unzähliger anderer Tier- und Pflan-zenarten in diesem klar
definierbaren Zeitraum zwischen Oberkreide und Danium hatte so
seine Erklärung.
1991 folgte die Entdeckung des Chicxulub-Kraters
im Norden der Halbinsel Yucatán im Golf von Mexiko (Durchmesser
ca. 180 km). Die Anerkennung dieses Impaktes als "Global Killer"
und seines Niederschlags in den bekannten Iridium-reichen
Grenzschichten war in der wissenschaftlichen Diskussion zunächst kein Selbstläufer. Inzwischen haben jedoch
sehr viele weitere detaillierte Untersuchungen die damaligen
Annahmen bestätigt. Eine ganze Reihe physikalischer, chemischer,
geologischer und biologisch-ökologischer Aspekte des
ausgelösten "Impaktwinters" wurden erkannt und beschrieben. |
| |
|
|
| |
Auf Grund der Bedeutung von Stevns Klint für diese Erkenntnisse
wurde das Kliff 2014 in die Liste der Welterbe-Stätten
aufgenommen.
Die dünne Grenzschicht
aus Fischton, nur 5 - max. 10 cm breit
|
|
 |
| |
| Ein Blick über den Klippenrand gibt zu erkennen, dass der
Kreidefels sich unter der Wasseroberfläche fortsetzt -
nah am Ufer noch dicht unter der Ober-fläche. (Um Helgoland
herum können wir eine solche Schorre-Situation im
dortigen Felswatt direkt erleben und bei Ebbe teilweise betreten.)
Wo sich
am Stevns Klint ein schmaler Strandsaum temporär auf der felsigen Schorre
unter dem Überhang halten kann, ist es zumeist ein grauschwarzer Feuerstein-Geröllstrand.
Die niederbrechenden Kalksteine halten dem Wasser nicht lange
stand. Bei starkem Wellenschlag kann das Wasser am Kliff milchig
trüb von ausgeschlemmter Kreide werden. |
|
 |
| |
|
Im ehemaligen Steinbruch von Boesdal kann der Bryozoenkalk etwas
genauer betrachtet werden. Auch hier fällt die wellige, von
Feuersteinschichten nachgezeichnete Lagerung auf
- wie am Bulbjerg. Sie gibt den hügelförmigen Bau der
Moostierchen-Kolonien am Meeresboden wieder. |
| |
Das im Kreide- und Danienkalk derart verbundene Auftreten von
Kalkstein und Feuerstein ist eine auffällige
Besonderheit und ist hinsichtlich seiner Genese immer noch mit
Fragen verbunden - wie allerdings, das müssen wir zugeben,
alle materielle Existenz in ihren vielfältigen
Erscheinungsformen.
Kalk und Kieselsäure sind zwei sehr unterschiedliche
mineralische Substanzen.
Kalk ist unverzichtbar verbunden mit der
Entstehung des tierischen und nachfolgend auch menschlichen Körpers. In
seinem erdgeschichtlich frühen Erscheinen tritt er auf in Form
von Kalkschalen von Mikroorganismen, von Mehrzellern, Mollusken
u. a. Die weitergehende Evolution benötigte ihn dann zum Aufbau des
Innenskelettes und der Zähne - so auch für uns Menschen.
Der Kalk hat somit tragende, stützende, schützende Funktionen.
Kalkstein entstand als Ablagerungsgestein aus den
Schalenresten der genannten Tiere - innerhalb einer
einst lebensvolleren Erde in gewaltigen Massevolumen.
Kalkstein ist von unterschiedlicher Dichte und Härte -
aber insgesamt aufgrund seines biogenen Ursprungs nicht
verwitterungsrobust. Die weiche, poröse Kreide ist das weichste
Gestein, das wir kennen.
Kieselsäure ist weniger sichtbar, spielt aber
in sehr vielen Lebensfunktionen - in pflanzlichen, tierischen,
menschlichen Organismen - als Spurenelement eine essentielle
Rolle. Ebenso vielfältig, sogar von regulativer Bedeutung findet
sich die Kieselsäure in der Gesteinswelt, d. h. deren Einteilung
erfolgt entsprechend dem Kieselsäuregehalt. In den
magmatischen Gesteinen ist die Kieselsäure sowohl "verborgen" in
vielerlei Silikaten als auch offenkundig in Form von reinem
Quarz (SiO2) enthalten. Im Vorgang der Verkieselung (Verquarzung
oder Silifizierung) dringt die Kieselsäure in vorhandene
Gesteine oder abgestorbene biogene Körper ein und ersetzen
vorhandene Substanzen.
Als mineralische Substanz bzw. als Gestein ist Quarz/Quarzit
splittrig hart. Ursprünglich klar durchsichtig (Bergkristall)
ist er offen für die Einlagerung feinster farbgebender Minerale
und kann dadurch alle Farbnuancen annehmen.
In den schwarzen Feuersteinlagen im weißen Kreidekalk tritt das
nahezu Härteste und Dunkelste unserer Gesteinswelt
vergesellschaftet mit dem Hellsten und Weichsten auf. Oft wird
gefragt: warum so?
|
| |
 |
|
Der Feuerstein ist wie der Kalk organischen
Ursprungs, das belegen Relikte von Kieselalgen und
Kieselschwämmen in ihm. Ein frühes Stadium seiner Entstehung
waren gelartige, wabernde Kieselsäure-Schichten im Kalkmeer -
wässrig-weiche Kieselsäureanreicherungen, die wir so heute nicht
mehr kennen. Es ist davon auszugehen, dass damals auch eine
umfangreiche Verkieselung vorhandener Kalksubstanz stattfand.
Während der folgenden Diagenese (Gesteinsverfestigung) wurde das
enthaltene Wasser nach und nach abgegeben - es entstand ein
amorpher Opal. Bänderun-gen und wolkige Einschlüsse, wie auch
der unregelmäßig knollenartige Rand der Feuersteinschicht deuten
unterschiedliche Grade der Verkieselung des Kalkes
an.
Im Bild erkennbar: eine dünne
silifizierte Kalkschicht umgibt gleich einer Rinde den
Feuerstein. |
|
|
|
|
 |
|
Der im Feuerstein verfestigte Quarz ist nicht kristallin,
sondern eine Chalcedon-Variante, feinfaserig ausgebildet -
was allerdings dem bloßen Auge nicht erkennbar ist. Gelegentlich
kann man bläulichen Chalcedon als Belag oder
Schliere im Feuerstein antreffen.
So intensiv blau wie hier im eh. Steinbruch Boesdal allerdings
selten. Der blaue Farbeindruck entsteht nicht durch mineralische
Beimengungen sondern durch Lichtbrechung an den Fasern. |
| |
| |
Die Kalkgesteine
der Kreide-Zeit
und des Daniums
schließen - in der nebenstehenden Darstellung des
Präquartären Untergrunds - an den präkambrischen Gebirgsgrund
des baltischen Schilds an. Unter den eiszeitlichen Ablagerungen
bilden sie ein breites Band von Nordwesten nach Südosten.
In Hellgrün wiedergegeben: das Danium. Gekennzeichnet ist die
Lokalität des Stevns Klint.
|
|

bearbeitete, vereinfachte Skizze nach Angaben in GEUS:
Bedrock geology of Denmark |
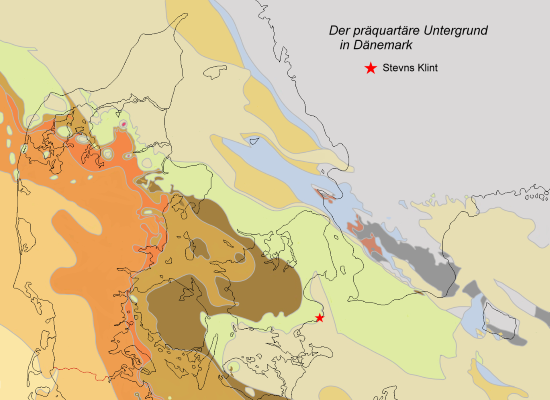 |
| |
| |
| |
Literatur:
Surlyk F. et al. 2006: Stevns Klint, Denmark: Uppermost
Maastrichian chalk, Cretaceous-tertiary boundary, and lower
Danian bryozoan mound complex. DGF, ISSN 0011-6297.
Alvarez L. W. et al. 1980: Extraterrestrial cause for the
Cretaceous-Tertiary Extinction. Science, Vol. 208, Nr. 4448
|
als PDF aufzurufen:
Damholt, T. u. Surlyk, F. 2012: Nomination of Stevns Klint for
inclusion in the World Heritage List. KULTURARV / GEUS
geoviden - geologi og geografi nr. 03, 2014. Stevns Klint
- ny dansk verdensarv.
|
Links:
https://www.spiegel.de/geschichte/mekkas-der-moderne-stevns-klint-a-946442.html
https://whc.unesco.org/en/list/1416 (Nominierung als Unesco-Welterbe)
https://www.scinexx.de/service/dossier_print_all.php?dossierID=91215
(Dossier im Wissensmagazin "scinexx" zum Massenaussterben am
Ende der Kreidezeit, Iridium-Anomalie, Chicxulub-Krater...)
https://videnskab.dk/naturvidenskab/fisken-i-fiskeleret-et-gammelt-mysterium-optrevles
(Details zum Fischton)
https://de.wikipedia.org/wiki/Chicxulub-Krater
https://idw-online.de/de/news763801 (Informationsdienst
Wissenschaft Feb. 2021)
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abe3647 (Science
Advances: "Globally distributed iridium layer preserved within
the Chicxulub impact structure")
https://www.fr.de/wissen/asteroid-loeschte-dinosaurier-aus-direkt-nach-einschlag-geschah-studie-12990916.html |