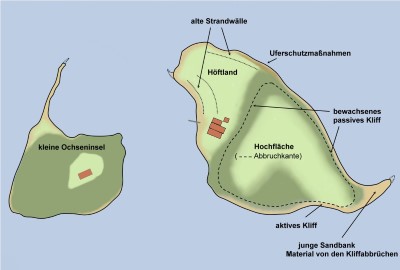Landschaft - Im Ostseeraum -
Die Flensburger Förde
Flensburger Förde
|
Kluesries
| Krusauer Tunneltal
| Kollunder Wald |
Meierwik |
Holnis
| Geltinger
Bucht
Geltinger Birk |
Habernis
Kliff |
Habernis Bucht und Moor |
Wahrberg |
Höftland bei Bockholmwik
|
|
|
|
|
Die Ochseninseln in der Flensburger Förde |
|
|
|
 |
Nahe dem dänischen Ufer bei Sønderhav liegen zwei kleine
Inseln. Sie sind auf kleinem Raum erstaunlich hoch - die
größere ist etwa 7,5 ha groß und hat eine Höhe von 15 m.
Es sind Kuppen, die ursprünglich zu dem nördlichen
Randmoränenzug des Fördegletschers gehörten, bis sie
durch die postglaziale Flutung des Fördetals abgetrennt
wurden. Zwischen den Inseln und dem dänischen Ufer
befindet sich eine Flachwasserzone mit max. 2 m Wassertiefe.
Eine erste urkundliche Erwähnung als Inseln ist aus dem
13. Jh. dokumentiert.
Der Name („Oxenøen“) geht auf die seit dem Mittelalter ausgeübte
Nutzung als Viehweidefläche zurück.
|
| die Ochseninseln von Sønderhav
aus gesehen |
|
|
|
Die kleine Insel ist heute gänzlich bewaldet und auf
Grund der Nutzung durch einen dänischen Lehrerverein öffentlich nicht
zugänglich. Sie hat auf der Südwestseite ein niedriges, partiell aktives
Kliff und fällt nach Nordosten flach ab.
Die große Insel ist klar gegliedert:
- ein ungefähr dreieckiges Geschiebemergel-Plateau als Weideland, steil
nach allen Seiten abfallend. Die Hochfläche fällt insgesamt etwas nach
Osten ein. Die Kliffhänge sind bewaldet bis auf das hohe, aktive Kliff
im Süden, das sich auch schon etwas buchtig in die Grundfläche des
Plateaus hineingefressen hat.
- im Norden eine Höftfläche (die Spitze der Landzunge lässt erkennen,
dass sie zumindest partiell einmal Nehrung gewesen war) mit zwei alten
Strandwällen, im Schutz des Kliffs die Gebäude, im Osten eine
Uferschutzmaßnahme (aus mittelgroßen Geschieben).
- der Sandhaken im Osten, eine junge, flache Landzunge aus den
Kliffabbrüchen des aktiven Kliffs. |
|
|
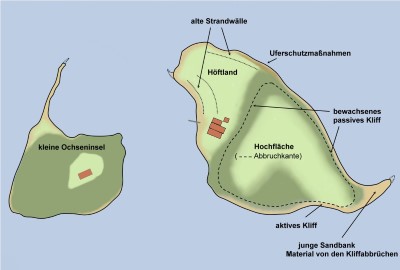 |
 |
 |
 |
 |
 |
| das Kliff im Süden |
alte Strandwälle auf
dem Höftland |
aktives Kliff im Süden |
der
Sandhaken |
ein Bewohner der
Hochfläche |
 |
Zugangsmöglichkeiten zum Plateau gibt es
einerseits hinter den Gebäuden auf der Nordseite, andererseits
an der Sandbank. Oben kann man
auf einem Pfad einem kleinen Rundweg folgen,
an wenigen Stellen ist über den Bewuchs des
Steilhangs hinweg ein Blick über die Förde möglich.
Eine Umrundung der Insel entlang der Wasserlinie ist meist nicht
möglich, weil auf der Westseite ein Strandstreifen kaum
vorhanden bzw. durch niedergebrochenes
Gestrüpp versperrt ist.
|
| Blick über die Flensburger Innenförde
Richtung Flensburg |
|
| |
|
| |
| Das ca.
50 m lange offene Kliff fällt senkrecht ab,
derzeit zum Teil sogar überhängend. Man kann recht gut erkennen,
dass der Wellenschlag den schluffigen Beckenton an der Basis
stark beansprucht und ausspült. Das Kliff besteht insgesamt aus
Geschiebemergel, der arm an Steinen ist und oberhalb eines
Beckenton-Sockels einen interessanten kreidereichen Horizont
aufweist. |
 |
|
|

|
|
überhängendes Geschiebemergelkliff |
kreidereiche Fliessablagerungen |
|
|
|
 |
Ins Auge fällt die untere, ca. 3 cm
breite Kreideablagerung.
Sie ist so homogen und dicht, dass sie als perfekt
zermahlene, eingeschlämmte und nahezu rein
abgesetzte Schreibkreide-Substanz erscheint.
Der Förde-Gletscher muss einen ordentlich großen Kreidebrocken
mitgebracht und verarbeitet haben … |
|
 |
Die
oberen, im Wechsel mit brauneisenhaltigen Sanden fein
geschichteten Ablagerungen enthalten kleine Kreidegerölle,
sodass hier die Situation eines rhythmischen Absetzens im
(vermutlich gering bewegten) Schmelzwasser gegeben ist.
Oberhalb die etliche Meter hohe, einheitliche
Geschiebemergelwand: anhaltend stabile Wetterlage
an der Kältefront?
|
|
 |
Interessant ein aufrecht stehender, schwarzer Flint. Seine
Position lässt vermuten, dass er 1. eingefroren war, 2. kein
seitlich schiebender Druck ausgeübt wurde (sonst hätte er
sich flach gelegt). Vielmehr bewirkte der Druck von oben
und der sukzessive Entzug des Wassers im Till, dass er
zwar wie ein „Atlant“ den Abstand zwischen zwei Horizonten zu
halten „versucht“, aber natürlich nicht verhindern kann, dass
die ursprüngliche, wassergesättigte Schichtbreite zu seinen
beiden Seiten auf die Hälfte schrumpfte. Er selbst
ist zu hart, um von dieser Verdichtung betroffen zu werden, legt
aber für uns nun Zeugnis davon ab.
|
|
 |
Die kleine, eingekeilte Scholle aus Kreideschlamm und –geröllen,
mit kleinen Flintstücken durchsetzt, weist auf spätere
Überschiebung früherer Ablagerungen hin.
Unter ihr der dunklere, schluffige Ton, schräg gestellt,
steinarm und fett, eine der Beckenablagerungen, an denen
die
Flensburger Förde reich ist.
|
|
Eingehendere Untersuchungen könnten diese nur aus dem Augenschein
formulierten Eindrücke bestätigen, ergänzen oder korrigieren. |
| |
| |
| Auch der Freund kristalliner Gesteine wird fündig (mitnehmen nur
in Form von Fotos erlaubt!): |
 |
Ein von der Abendsonne beschienener
Roter Ostsee-Quarzporphyr.
Charakteristisch die (im trockenen Zustand)
ziegelrote Farbe und die dunklen Quarzsplitter.
Weitere (Feldspat-) Einsprenglinge sind gleichfarbig
mit der Grundmasse und fallen deshalb nicht auf.
|
| |
|
 |
 |
|
Zwei Åland-Granite
unterschiedlicher Ausprägung.
In beiden ist die Grundmasse durchsetzt mit feingraphischen
Verwachsungen aus Kalifeldspat und Quarz, in geringerem Maß im
roten Granit, hingegen in zauberhaft schönen keilschriftartigen
und federförmigen Mustern im hellen Granit. (Lupe!) |
 |
 |
|
Ein Vang-Granit, als anstehend
bekannt von der Insel Bornholm.
Rechts zum Vergleich eine Insitu-Gesteinsprobe von Jons Kapel, Bornholm. |
|
|
|
Zwei einsprenglingsreiche Dala-Porphyre: |
 |
 |
|
Links ein Grönklitt-Porphyrit,
mit sehr vielen kleinen, leistenförmigen
Plagioklas-Einsprenglingen, er zeigt hier die seltenere Textur
mit eingeregelten Feldspatleisten (= leichtes Fließgefüge des
Magmas).
Rechts ein einsprenglingsreicher Dalarna-Porphyr
mit viel grünlich alterierten Plagioklas-Feldspäten und
rötlicher Grundmasse, er kann im Allgemeinen häufig gefunden
werden. |
| |
| |
| Vor dem Gehöft auf der Insel steht eine Skulptur der besonderen Art,
die aus jeder Richtung betrachtet neu die Fantasie anregt - und zeigt,
was Verwitterung am Sandstein kann und tut: |
Infos über die Inselgeschichte über:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ochseninseln
und:
www.visitkrusaa.dk/Startseite/Museen%2C+Austellungen+und+Natur/die_ochseninseln.htm
eine Luftaufnahme ist zu sehen über:
http://www.flensburg-online.de/az/az-ochseninseln.html
Gerhard Moltsen: „Die Geschichte der Ochseninseln und ihre Bewohner“,
Schleswig 1982, ist eine ausführliche, lebendig erzählte Chronik der
Inselgeschichte